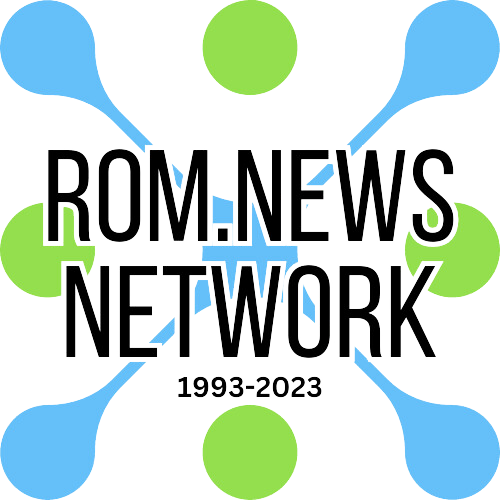Die Heimatlosen
Der deutsche Staat zahlt jährlich Millionen, um Menschen zu unterstützen, die er in andere Länder abgeschoben hat. Was bringt das? Besuch bei einer Mutter und ihren Kindern aus Tübingen, die seit zwei Jahren im Kosovo leben.
Die Kinder schliefen schon, sie hatte geduscht und noch ein bisschen ferngesehen, als es an der Tür klingelte und Kiza Mustafa, 30, ihre Heimat verlor. Sie dachte, es sei ihr Bruder. Es waren Polizisten. Sie sagten: „Sie müssen jetzt Deutschland verlassen.“
Kiza Mustafa war zwei Jahre alt, als ihre Eltern aus dem Kosovo flohen. Sie wuchs in Tübingen auf, riss mit 16 Jahren von zu Hause aus und zog zu ihrem Freund nach Gelsenkirchen. Sie brach die Schule ab, brachte drei Kinder zur Welt, bezog Sozialgeld, hatte Stress mit den Nachbarn.
Es war kein musterhaftes Leben. Aber es war vertraut, sie kannte sich darin aus.
Dann entschied der deutsche Staat: Kiza Mustafa und ihre Kinder Medina, Ali und Ismet gehören in den Kosovo. Charterflug Karlsruhe/Baden-Baden nach Pristina, im Mai 2016. Der Beruhigungssaft, den Mediziner Kiza Mustafa vor dem Start gaben, war pink und schmeckte wie Hustensirup. Er habe nicht geholfen, sagt sie.Die HeimatlosenFremde Heimat: Abgeschoben in den KosovoVolume 90% SPIEGEL ONLINE
Fast 120.000 Menschen wurden seit 2008 in ein Flugzeug gesetzt und aus Deutschland abgeschoben. Wie lange sie vorher hier gelebt haben, wertet niemand aus. Doch immer wieder trifft es jene, die ihr ganzes Leben hier verbracht haben.
Bivsi Rana war so ein Fall. Gegen die Abschiebung der Duisburger Schülerin nach Nepal protestierten im vergangenen Jahr so viele Menschen, dass ihre Familie zurück nach Deutschland kommen durfte.
Doch was ist mit denen, die weniger Fürsprecher haben? Wie geht es ihnen in einem Land, dessen Sprache und Regeln sie nicht kennen? Wie können sie dort ankommen?
In einer Hütte aus Ziegeln
Gras wächst zwischen den Bahngleisen, die durch Plemetina schneiden. Das kosovarische Dorf liegt 15 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Pristina. Ein Kohlekraftwerk raucht neben der Ortseinfahrt wie ein ungehaltener Drache. Heckenrosen ranken sich um rostige Zäune.
In einer Hütte aus Ziegeln streicht Ismet, der Jüngste, um Kiza Mustafas Beine und quengelt. „Mama, hast du Chips?“ Er ist sieben Jahre alt und lispelt durch seine Milchzahnlücken. „Ismet, nerv nicht“, entgegnet seine Mutter. Beide sprechen akzentfreies, grammatikalisch etwas holpriges Deutsch. „Mama muss Holz hacken.
Leben in Plemetina21
Kiza Mustafa träumte als Mädchen davon, Tanzlehrerin zu werden. Manchmal tanzt sie noch mit ihrer Tochter Hip-Hop, auf dem Teppich in der Ziegelhütte. „Dann mach ich einfach die Musik laut und fühle mich, als wäre nichts passiert“, sagt sie. Seit sie im Kosovo ist, schminkt sie sich nicht mehr. Sie hat abgenommen, ihre zierlichen braunen Arme sind stärker geworden.
Kiza Mustafa schleppt einen Baumstamm auf die Wiese vor der Hütte, er ist so dick wie ihr Bein. Sie klemmt eine Bügelsäge hochkant unter ihren Fuß und zerrt den Stamm mit beiden Händen übers Sägeblatt, immer wieder. Bis der Schnitt tief genug ist und sie den Stamm aufs Gras niedersausen lässt. „Noch ein Schlag und tschüs!“ Das Holz zerbricht.
„Ich habe mich mal bei einer Tanzschule in Tübingen beworben“, sagt Kiza Mustafa. Doch einen Job habe sie nicht bekommen, auch keinen als Verkäuferin, weil sie immer nur eine Duldung gehabt habe. Es lag wohl auch am fehlenden Schulabschluss.
Eine Feststellung, keine Beichte
Sie hätte gute Chancen auf einen Aufenthaltstitel gehabt, wenn sie die Schule beendet und eine Ausbildung begonnen hätte. Ihre Eltern und Geschwister leben noch in Deutschland. Sie haben Jobs und Lehrstellen gefunden. Ihre Eltern durften aus humanitären Gründen bleiben, weil ihre Mutter Krebs bekam.
Kiza Mustafa weiß, dass sie Fehler gemacht hat. „Ich habe meinen Arsch nicht hochgekriegt.“ Es klingt wie eine Feststellung, nicht wie eine Beichte.
So sieht es auch eine Nachbarin, die in Tübingen jahrelang direkt gegenüber wohnte. Kiza Mustafa habe ihre Wohnung nicht geputzt, den Müll nie rechtzeitig herausgestellt, ihre Kinder vernachlässigt und ständig nur geschlafen. „Als Mutter war sie eine Null.“
„Innendrin fühle ich mich immer noch wie ein Mädchen, nicht wie eine Mutter“, sagt Kiza Mustafa, die drei Kinder bekam, bevor sie gelernt hatte, für sich allein zu sorgen. Sehr jung verliebte sie sich in einen Jungen, für den sie alles tun wollte. Sie trafen sich in einem Dating-Chat und telefonierten rund um die Uhr. „Das ist doch Liebe, oder?“
Es störte sie, dass ihre Mutter strikt gegen die Telefonate war. Und er drängte auf ein Treffen. So machte sie sich schließlich hübsch und trug freiwillig den Müll raus. Als sie die Tüte weggeworfen hatte, rannte sie zum Bahnhof und fuhr zu ihm nach Gelsenkirchen. „Ich habe ihm gesagt, dass ich noch zu jung für ein Baby bin“, erinnert sie sich, „aber er wollte nicht verhüten.“ Ein Jahr später kam ihre Tochter zur Welt.
„Ich bin eine deutsche Frau“
Die Liebe verblasste, und Kiza Mustafa zog mit ihren drei Kindern zurück nach Tübingen. Sie wurde auch allein mit ihnen abgeschoben. Täglich zerkleinert sie nun Äste zu Feuerholz, damit sie keinen Strom zahlen muss. Sie kochen im Haus des Onkels nebenan und gehen dort auf die Toilette. Jeden Monat schicken die Eltern aus Tübingen mal 50 oder mal 100 Euro. Es reicht für Lebensmittel. Um mehr Geld mag sie nicht bitten. „Ich will nicht, dass meine Mama sich Sorgen macht.“
Sie würde Medina, Ali und Ismet gern duschen, wie früher, wo sie auf Fliesen standen und nicht auf festgestampfter Erde. Wo sie drei Zimmer, Küche, Bad hatten und Scheiben in allen Fenstern.
Jetzt gießt sie den Kindern aus einem Einmachglas Wasser über die Haare. Sie stehen neben einem Haufen schmutziger Wäsche, in der Abstellkammer, die mal ein WC werden sollte. Das Wasser versickert langsam im Boden. „Als ich meine Kinder zum ersten Mal so gewaschen habe, habe ich geweint“, sagt Kiza Mustafa.

Sie raucht viel und schwäbelt, wenn sie spricht und seit ihre Heimat so fern ist, ist sie ihr noch näher gerückt. Kiza Mustafa weiß, dass sie den deutschen Staat viel gekostet hat. Was das mit dem Kosovo zu tun haben soll, versteht sie nicht. „Ich bin doch eine deutsche Frau.“
Doch Gesetz und Gefühl liegen oft weit auseinander. Als der Kosovo 2015 zum sicheren Herkunftsland erklärte wurde, stiegen die Abschiebungen dorthin sprunghaft an. Ein Jahr später musste Kiza Mustafa gehen – zusammen mit knapp 5000 anderen, die Asyl gesucht und nicht bekommen hatten.
Man kann nicht sagen, dass sich die deutschen und örtlichen Behörden gar nicht um die Rückkehrer kümmern. Der Kosovo hat auf Druck der EU und in der Hoffnung auf erleichterte Visabestimmungen ein Behördennetzwerk aufgebaut, das sie dabei unterstützen soll, sich „nachhaltig zu reintegrieren“.
Am Flughafen in Pristina registrieren Mitarbeiter der kosovarischen Regierung Ankömmlinge und besuchen sie später in ihren neuen Wohnorten, um sie, falls nötig, mit Lebensmitteln, kostenlosen Unterkünften, Jobtrainings oder Zuschüssen zu Firmengründungen zu versorgen.
Etwa jeder zweite Rückkehrer profitiert laut Innenministerium davon. Auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), die Arbeiterwohlfahrt, die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ und lokale Hilfsorganisationen wie Balkan Sunflowers beraten und unterstützen Rückkehrer.
Das Beratungszentrum des Bamf in Pristina kostet die deutsche Regierung jährlich rund eine Million Euro. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) stellt von 2017 bis 2020 für den Kosovo 16 Millionen Euro zur Verfügung. Im Rahmen seines Programms „Perspektive Heimat“ fließen insgesamt 150 Millionen Euro auch in andere Länder, darunter Serbien, Ghana, der Senegal, Tunesien, Nigeria und Afghanistan.
Das Engagement hat im Kosovo allerdings Haken.
Erstens: Wie nachhaltig kann die Hilfe sein, wenn die Arbeitslosigkeit bei über 30 Prozent liegt? Für höchstens eineinhalb Jahre können Rückkehrer offizielle Unterstützung beantragen. Dann ist Schluss, egal ob sie bis dahin einen Job gefunden haben.
Zweitens: Wird die Hilfe gerecht verteilt? Die Behörden begünstigten Albaner und benachteiligten Roma und andere Minderheiten, kritisiert unter anderem die Gesellschaft für bedrohte Völker, die dazu 2016 eine Studie durchgeführt hat.
„Alle wichtigen Ämter sind von Albanern besetzt, auch in den deutschen Projekten“, sagt Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat, der die Unterstützung für Rückkehrer im Kosovo untersucht hat. „Roma haben wenig zu sagen und zu erwarten.“
Das System sei fair und effizient, verlautet es aus dem Innenministerium. Offiziellen Statistiken zufolge profitieren Angehörige von Minderheiten sogar überproportional stark von den staatlichen Hilfen für Rückkehrer. Allerdings bekommen sie häufiger Lebensmittel und nur selten Weiterbildungskurse bezahlt.
Das Elternhaus, eine Ruine
Kiza Mustafa gehört zu den Roma. Und sie ist durchs System gerutscht. Die Familie sei nicht in der offiziellen Datenbank registriert, heißt es aus der zuständigen Behörde MOCR, die Hausbesuche bei Rückkehrern machen soll. Sie habe nach der Landung am Flughafen in Pristina zum Bus rennen müssen und deshalb nur ihren Vornamen in die Liste eintragen können, sagt Kiza.
Sie ist ein schwieriger Fall, auch weil es bei ihr nicht um „Reintegration“ geht. Kiza lebte 26 Jahre lang in Deutschland. Jetzt lebt sie im Dorf ihres Vaters, neben dem Steinhaufen, der von dem Haus noch übrig ist, in dem er geboren wurde, und soll sich aus der Vergangenheit eine Zukunft bauen. „Die wollen uns Ausländer hier nicht“, sagt sie.
Ihre Kinder gehen seit zwei Jahren nicht zur Schule. Kiza Mustafa hat sehr lange gebraucht, um den Rektor der Schule persönlich zu bitten, Medina, Ali und Ismet aufzunehmen. „Ich wusste nicht, wo er ist, ich kannte ihn nicht“, sagt sie. Die Schule ist zwei Minuten Fußweg entfernt. Doch sie traut sich selten vor die Tür. Auch weil sie kein Albanisch und nur sehr wenig Serbisch spricht.
Keine Schule für Ali und Medina
In Tübingen kam mehrmals in der Woche ehrenamtlich eine pensionierte Erzieherin vorbei, um die Kinder pünktlich zum Kindergarten zu bringen. Auch das Jugendamt schickte regelmäßig eine Betreuerin, um mit Kiza Mustafa zu üben, wie sie gesund einkauft, wie sie ihr Geld sinnvoll ausgibt, wie sie mit ihren Kindern Stockbrot im Wald backt.
Diese Zeit ist jetzt vorbei. Und sie fehlt nicht nur der Mutter.
Drinnen in der Ziegelhütte, die nun sein Zuhause ist, sitzt der achtjährige Ali auf einem Sofa. Herzförmiges Gesicht, wache Kulleraugen. Zwischen den Teppichen unter seinen Füßen lugt der Betonboden hervor. Aus Alis linkem Plastikschlappen guckt ein Zeh. Er spricht immer noch gut Deutsch. „Ich möchte zur Schule“, sagt Ali.

Seine Schwester Medina ist neun Jahre alt und sie hat gelernt, Holzscheite mit einem Beil zu spalten, ohne sich zu verletzen. Sie hätte auch gern lesen und schreiben geübt. „Ich will Ärztin werden“, sagt Medina.
Man kann ihrer Mutter vorwerfen, dass sie sich nicht genug angestrengt hat, um in Deutschland bleiben zu dürfen. Und man kann dem deutschen Staat vorwerfen, dass er ein Problem abgeschoben hat, das seither nur noch größer geworden ist. Und dass er die Zukunftschancen dreier wissbegieriger Kinder seiner Asylpolitik geopfert hat.
Zwar schaut auch in Plemetina ein Sozialarbeiter nach der Familie. Er hat monatelang auf Kiza Mustafa eingeredet, dass sie sich endlich um einen Schulplatz für ihre Kinder bemühen soll. Aber er hat es ihr nicht abgenommen. „Ich will ihr helfen, aber sie muss es auch wollen“, sagt Agron Mustafa.
Er arbeitet für die Hilfsorganisation Balkan Sunflowers, die in dem Ort ein Nachhilfezentrum betreibt. Doch dort dürfen nur Kinder lernen, die bereits in der Schule sind. Man wolle keine Konkurrenz zum staatlichen Unterricht sein, sagt der 27-Jährige, der zwar denselben Nachnamen trägt, aber nicht mit Kiza verwandt ist.
Der Rektor, ein freundlicher Herr
Agron Mustafa gehört auch zu den Roma und während das Haus von Kizas Vater verfiel, baute sich Agrons Familie in Plemetina etwas auf. Ihr Haus steht in derselben Straße, mit Fliesen, Waschmaschine, Einbauküche.
Zur Leitung der serbischen Schule, auf die Kiza Mustafas Kinder gehen möchten, weil sie ein paar wenige Worte Serbisch sprechen, hat seine Hilfsorganisation jedoch keinen guten Draht.
Die Stimmung zwischen Albanern, Serben, Roma und anderen ethnischen Gruppen ist im Kosovo angespannt und vieles ist zweigeteilt, zum Beispiel das Gesundheits- und Bildungssystem. Es gibt noch eine albanische Schule in Plemetina. „Wenn ich sie betreten würde, würde mich der Rektor der serbischen Schule für einen Spion halten“, sagt Agron Mustafa ernst.
Zum Glück entpuppte sich der Rektor den Kindern gegenüber als freundlicher Herr, als Kiza Mitte Mai endlich bei ihm war. Er will Ali und seine Geschwister ab September erst mal ohne Sprachtest, übersetzte und beglaubigte Geburtsurkunde und andere Dokumente aufnehmen. Jedem dritten Rückkehrerkind, das Balkan Sunflowers betreut, verbauen solche Hürden monatelang den Schulbesuch.
Ali, Medina und Ismet haben im Kosovo neue Freunde gefunden. So wie Fabian, der Weizenähren wie Raupen über seine Unterarme wandern lassen kann. Es kümmert sie noch wenig, dass sie nun in einem der ärmsten Länder Europas leben, das als hoch korrupt gilt und keine gesetzliche Krankenversicherung kennt.
Wahrscheinlich werden sie es im Kosovo schwer haben. Während des Kriegs Ende der Neunzigerjahre wurden Roma dort von albanischen Nationalisten massiv vertrieben und verfolgt. Noch immer leiden sie vielerorts unter Diskriminierung.
„Ich will nur hier weg“
Doch unmöglich ist es nicht, dass Medina, Ali und Ismet in ihrer neuen Heimat glücklich werden. Es gibt Roma, die studieren, Arbeit finden, erfolgreich und vor allem zufrieden sind. So wie Agron, der Sozialarbeiter. Oder wie Kizas Cousin Adrijan, der als Putzmann jobbt. Beide sagen, sie leben gern in Plemetina.
Für Kiza Mustafa kommt dieses Leben nicht infrage. „Ich will nur hier weg.“ Sie will es so dringend, dass sie etwas tut, was ihr als Jugendliche schon einmal viele Chancen verbaut hat: Sie setzt auf ihren Mann.
Sie hatten sich längst getrennt, seit Monaten haben sie nicht mehr telefoniert. Nachbarn erzählen, er habe sie früher häufig geschlagen. Trotzdem wartet sie darauf, dass der Vater von Medina, Ali und Ismet ebenfalls abgeschoben wird.
Er kenne viele einflussreiche Leute, sagt Kiza Mustafa. Sie hofft, dass sie dann zusammen aufbrechen, zurück in die Heimat, die sie nicht will. Vielleicht werden sie sich auf den gefährlichen und illegalen Landweg machen, den schon so viele vor ihnen gegangen sind.
Es wird dann wenig zählen, ob die Kinder sich in der neuen Schule eingewöhnt haben. Und dass Deutschland nur noch jedem hundertsten Asylsuchenden aus dem Kosovo Schutz gewährt. „Mein Herz sagt mir: Mein Mann wird alles tun, um uns hier rauszuholen“, sagt Kiza Mustafa. Und an sein Herz müsse man glauben.
Quelle: Spiegel