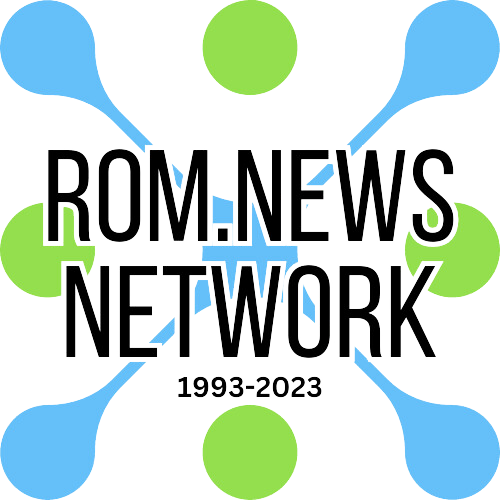Spigel 06.03.2021, 16.07 Uhr:
Der Musiker Markus Reinhardt sagt: »Ich will gerne Zigeuner genannt werden«. Der Bürgerrechtler Marko Knudsen lehnt den Begriff als rassistisch ab. Ein Streitgespräch über Fremdbestimmung, Klischees und Kulturerbe.Ein Interview von Arno Frank und Thomas Schmoll

SPIEGEL: Herr Reinhardt, es ist mit Beharrlichkeit ein Begriff im deutschen Sprachgebrauch, den viele Menschen als diskriminierend empfinden. Warum verwenden Sie ihn so offensiv?
Reinhardt: Das bin ja nicht nur ich, der sich Zigeuner nennt…
SPIEGEL: Sie malen gar keine Anführungszeichen in die Luft!
Reinhardt: Nein, warum? Ich gehöre hier im Rheinland und ganz Nordrhein-Westfalen einer großen Gemeinschaft an, der Gruppe der Sinti, und muss sagen: Die meisten wollen auch Zigeuner genannt werden, nicht Sinti und Roma. Es gibt so viele Stämme, »Sinti und Roma« wird ihnen nicht gerecht.
SPIEGEL: Warum nicht?
Reinhardt: Es gibt zu viele Untergruppen, die damit nicht angesprochen werden. Ich bin viel herumgekommen und kenne selber nicht einmal alle Stämme. »Die meisten der Zigeuner, die die Konzentrationslager überlebt haben, nannten sich danach auch weiter so.«
SPIEGEL: Aber das Schimpfwort wird allen gerecht?
Reinhardt: Für unsere Alten war das kein Schimpfwort, im Gegenteil! Das wurde erst im »Dritten Reich« negativ besetzt…
SPIEGEL: Im Nationalsozialismus wurde dem ohnehin abwertenden Begriff mit »ziehende Gauner« eine falsche Herkunftsgeschichte angedichtet und den Volksgruppen ein »Z« tätowiert.
Reinhardt: Ja, aber die meisten der Zigeuner, die die Konzentrationslager überlebt haben, nannten sich danach auch weiter so. Bis auf einen einzigen sagen alle Holocaustüberlebenden, mit denen ich für ein Zeitzeugenprojekt gesprochen habe, Zigeuner. Das waren sowohl Mitglieder meiner Familie als auch europäische Roma. Wir finden den Begriff der Sinti und Roma schrecklich, vor allem auch deshalb, weil Deutsche, die keine Zigeuner sind, über unsere Köpfe hinweg entschieden haben: Ab sofort heißt ihr Sinti und Roma.
Zur Person

Markus Reinhardt ist in Köln geboren und lebt dort. Er ist 63 Jahre alt und verdient sein Geld wie viele andere Mitglieder seiner Familie als Musiker. Reinhardt spielt Klavier sowie Violine und komponierte für Funk und Fernsehen. Sein Großonkel ist die Jazzlegende Django Reinhardt. Sechs der zwölf Kinder der Großeltern von Markus Reinhardt wurden von den Nazis ermordet.
SPIEGEL: Erklären Sie das.
Reinhardt: Das sind Begriffe aus unserer Sprache. Gerade die Sinti haben sich zurückgehalten und ihre Kultur in den Familien gelebt. Sie wollten gar nicht, dass man sie in ihrer eigenen Sprache anredet. Zigeuner ist das deutsche Wort. Warum sollte man das nicht weiter verwenden?
SPIEGEL: Weil viele Roma nicht so genannt werden wollen?
Reinhardt: Natürlich gibt’s die, und damit bin ich auch einverstanden. Roma in Rumänien wollen nicht Roma, sondern Tigani genannt werden. Das ist ihre Eigenbezeichnung. Wir leben seit 600 Jahren in Deutschland und haben ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Ich stamme aus einer Musikerfamilie, und die Zigeuner sind früher auf die Dörfer gezogen und haben dort den »Zigeunerbaron« von Johann Strass, die »Zigeunerweisen« von Pablo de Sarasate gespielt…
Zur Person

Marko D. Knudsen ist seit 30 Jahren aktiver Menschen- und Bürgerrechtler. Der Rom ist Gründer des Europäischen Zentrums für Antiziganismusforschung und Autor einer Geschichte der Roma und Sinti, Vorsitzender des Bildungsvereins der Roma zu Hamburg e.V. und tätig als Schulsozialpädagoge für das ReBBZ Hamburg als Roma-und-Sinti-Beauftragter.
SPIEGEL: Haben sie nicht auch einfach Klischees bedient?
Reinhardt: Sie haben die Operette, die Philharmonie, die klassische Musik zu Leuten gebracht, die das nicht kannten. Und das hat sie stolz gemacht! Das war eine Kultur. Wir haben sie gemacht und in diese Gesellschaft reingebracht. Wir deutschen Zigeuner leben seit 600 Jahren in dieser Gesellschaft. Wer kann das von sich behaupten? Ich veranstalte seit ein paar Jahren das »Zigeunerfestival« in Köln. Da kommen bis zu 3000 Menschen, alle, Musiker und Gäste, haben Spaß und sind happy. Da hat sich noch keiner beschwert, auch keiner der Roma-Künstler, die dort auftreten.
SPIEGEL: Haben wir Sie, Herr Knudsen, bei diesem Wort »Zigeunerfestival« zucken sehen?
Marko Knudsen: Ja, haben Sie. Wir haben es hier mit einer Fremdbezeichung zu tun. Auch wenn der Begriff als politisch inkorrekt gilt, findet er sich trotzdem fest verankert in der Gesellschaft. Die Gesellschaft braucht ihn, um sich den Zigeuner erklären zu können. Deswegen bin ich so radikal gegen diese Begrifflichkeit, denn sie existiert – sei es im Supermarkt, sei es auf Speisekarten oder sonst wo. Solange sie unhinterfragt dasteht, erhält sie eine Legitimierung in der Gesellschaft. Darum muss dieser rassistische, diskriminierende, antiziganistische Begriff komplett abgelehnt werden.
SPIEGEL: Kann man ihn, wie eine andere Beleidigung mit dem »N-Wort«, zum Verschwinden bringen?
Knudsen: Wer »Z-Wort« sagt, hat nur nicht den Mumm, Zigeuner zu sagen.
SPIEGEL: Es gibt Aktivisten, die halten selbst das Wort »Antiziganismus« nicht für angebracht, weil darin auch das Wort »Zigeuner« verborgen ist.
Knudsen: Antiziganismus ist ein Kunstwort, das von der Antiziganismusforschung eingeführt worden ist, um ein Äquivalent zu den Hasserklärungen gegenüber den Juden zu finden. Damit haben wir erst vor 20 Jahren begonnen. Da hinken wir 60 Jahre den Juden hinterher, die wesentlich schneller Wissenschaftler parat hatten, um über den Hass der Nazis aufzuklären und einen Begriff wie Antisemitismus einzuführen, bis heute darüber aufzuklären.
SPIEGEL: Worüber genau klären Sie auf?
Knudsen: Vor der NS-Zeit und noch danach waren wir alle Zigeuner. Es gab kein anderes Wort für uns. Wir sind ursprünglich Indoarier, man konnte uns also nicht wegen unserer ethnischen Herkunft verfolgen – sonst hätten sich die Nazis selbst ins KZ schicken müssen. Deswegen hat man uns als Volk kriminalisiert und dieses alte Konstrukt benutzt und noch weiter aufgebläht, um uns zu entmenschlichen – genau so, wie man es bei den Juden gemacht hat. Erst durch diesen Schritt war die Vernichtung möglich, Pharrajimos, der Genozid. Mit dem Begriff »Zigeuner« ist eine Inklusion der Sinti und Roma in diese Gesellschaft nicht möglich.
SPIEGEL: Glauben Sie, dass mit der Beseitigung antiziganistischer Bezeichnungen auch die Vorurteile verschwinden?
Knudsen: Nein. Selbst wenn wir den »Zigeuner« aus den Köpfen bekommen, haben wir damit noch nicht die antiziganistischen Vorurteile beseitigt. Aber wir haben sie benannt und aufgezeigt. Es muss Kopf für Kopf überzeugt werden.
Reinhardt: In dem Wort »Antiziganismus« steckt doch auch der Zigeuner drin. Ich war in Österreich auf Tournee, da habe ich ein Plakat gesehen: »Sinti und Roma raus!«. Der veränderte Begriff verändert nicht das Vorurteil.
Knudsen: 1995 starben vier Roma bei dem Versuch, ein Schild mit der Aufschrift »Roma zurück nach Indien« zu entfernen – darunter hatte der Attentäter eine Rohrbombe versteckt. Es ist doch egal, ob ich Zigeuner hasse oder Sinti und Roma.
Reinhardt: Eben. Das meine ich doch.
SPIEGEL: Worin besteht dann der Fortschritt, Herr Knudsen?
Knudsen: Wenn ich den Menschen den Begriff »Zigeuner« nehme, müssen sie sich eine andere Begründung für ihren Hass suchen. Das macht die Vorurteile sichtbar. Dann müssen sie sich mit den Roma und Sinti auseinandersetzen, und dann entstehen andere Bilder, die sich nicht von den traditionellen Vorurteilen ableiten. Verwenden kann ich das Wort nur in historischen Zusammenhängen, weil dieses Volk eben früher so genannt wurde. Wenn ich es heute verwende, dann nur, um damit irgendwas zu triggern.
SPIEGEL: Könnte denn das Wort, unabhängig von seiner Geschichte, nicht heute auch etwas Gutes triggern? Herr Reinhardt versucht doch, ihm einen positiven Klang zu geben.
Knudsen: Verwendet wird das Wort heute vor allem von Kulturtreibenden, Musikern oder Wahrsagern, die leben von einem positiven Antiziganismus…
SPIEGEL: Also Philoziganismus, der den »Zigeunern« romantisierende Stereotype zuschreibt?
Knudsen: Genau in dieser Blase bewegt sich eine große Gruppe. Und deshalb weigert sie sich auch so händeringend, den Begriff endlich fallen zu lassen. Es ist mir auch egal, ob sie ihn verwenden oder nicht. Hauptsache, sie tun es in einem vernünftigen Kontext.
SPIEGEL: Und ein Festival ist der falsche Kontext?
Knudsen: Es kann kein Kontext sein, in dem diese Begrifflichkeit gerechtfertigt oder als Bezeichnung für uns propagiert wird. Sie würden ja auch keinen DJ eine Herzoperation durchführen lassen.
Reinhardt: Ich denke, wir müssen mit diesem Begriff selbstbewusst umgehen. Wir müssen in diese Gesellschaft und mit dieser Gesellschaft reden und uns auseinandersetzen. Wir müssen aus dieser Opferrolle raus.
Knudsen: Egal, ob man sich Zigeuner nennt oder nicht: Wenn Sie Herrn Reinhardt kennenlernen, dann ordnen Sie diesen Menschen zu seiner Volksgruppe anders in Ihrem Kopf ein, als wenn Sie niemals einen Roma oder Sinti getroffen hätten – und dann können Sie sich mit der Begrifflichkeit Zigeuner auseinandersetzen und hinterfragen, ob Ihre Bilder im Kopf mit Ihren gemachten Erfahrungen übereinstimmen. Das wäre dann eine Reflexion über die eigenen Vorurteile.
SPIEGEL: Aber dann tut Herr Reinhardt mit seinem »Zigeunerfestival« und bis zu 3000 Besuchern doch eine ganze Menge für das Kennenlernen, oder?
Knudsen: Jein. Wenn wir zusammen feiern, ändert das noch nichts. Das hat den Nazis auch gefallen, wenn Zigeuner musiziert haben, gerne im KZ. Zeit ändert sich, Gesellschaft ändert sich, Sprache ändert sich. Auf unserer ersten Demo lief ich auch mit Plakaten herum, auf denen stand: »Schluss mit der Diskriminierung der Zigeuner«. Wenn ich auf ein Rap-Konzert gehe, macht mich das nicht unbedingt sensibler für den Rassismus Schwarzen gegenüber.
Reinhardt: Doch! Es ist nicht nur das Konzert. Wenn ich dieses Festival anders benannt hätte, dann wäre die Finanzierung ein Kinderspiel. Man hat uns offen gesagt: Ihr fördert dieses Festival, damit fördert ihr dieses Wort. Meine Konzerte wurden zum Teil abgesagt, weil ich dieses Wort benutzen wollte. Das muss man sich mal vorstellen! Wir kommen dort auch ins Gespräch. Es gab Menschen, die hatten Angst, zu uns zu kommen!
Knudsen: Warum hatten Menschen Angst, ein Konzert zu besuchen?
Reinhardt: Weil sie nicht wussten, was sie da erwartet: Zigeunerfestival? Bin ich da überhaupt erwünscht? Oder wollen die unter sich bleiben?
Knudsen: Dann hatten sie Angst vor dem Zigeuner. Das ist auch wieder Antiziganimus.
Reinhardt: Nein! Angst vor dem Fremden, die dort dann abgebaut werden kann im Gespräch. Wir haben auch Informationsveranstaltungen, Vorträge, man redet. So entstehen auch Freundschaften!
Knudsen: Freundschaften haben uns auch nicht davon abgehalten, ins KZ zu kommen.
Reinhardt: Das ist doch Quatsch. Wo sollen wir denn anfangen? Irgendwo müssen wir doch anfangen!
Knudsen: Es reicht nicht nur, sich kennenzulernen. Wir müssen damit anfangen, die in der Gesellschaft verankerten antiziganistischen Vorurteile und Bilder aufzubrechen. Wir müssen einen Marathon laufen. Aber manche binden sich dabei die Beine zusammen, wenn sie weiterhin den Begriff »Zigeuner« verwenden.
Reinhardt: Nein. Nicht, wenn du dich zeigst und offen zeigst und etwas von dir erzählst. Wir deutschen Zigeuner sind doch in dieser Mehrheitsgesellschaft drin! Wir sind auch nicht alle gleich.
Knudsen: Sind wir nicht. Aber wir müssen uns doch mal auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Wir können uns in Deutschland als Volk nicht einmal auf einen gemeinsamen Namen einigen!
SPIEGEL: Empfinden Sie sich auch schlicht als Deutsche? So wie Friesen oder Schwaben ebenfalls Deutsche sind?
Knudsen: Wir müssen unterscheiden zwischen der Zugehörigkeit zu einem Volk und der Staatsangehörigkeit. Ich selbst habe Einflüsse aus acht europäischen Nationen in mir und Schwierigkeiten, mich als Deutscher zu definieren. Ich bin Hamburger. Oder Europäer.
Reinhardt: Natürlich sind wir Deutsche, wir sind doch hier geboren. Auch wenn wir uns hier im Rheinland eher als Kölner fühlen.
SPIEGEL: Ist denn, wer von seinem Zigeunerschnitzel nicht lassen will, automatisch ein Rassist?
Reinhardt: Nein. Ich will mir auch von keinem Verband oder Verein sagen lassen, wann ich mich rassistisch beleidigt zu fühlen habe.
Knudsen: Diese leidige Debatte über die Speisekarte hätte ich gerne vermieden. Was geht es mich an, wie jemand sein Lieblingsessen nennt? Trotzdem kann ich nur als Betroffener beurteilen, was eine Beleidigung ist – und was nicht. Unser Volk ist genauso weit wie das deutsche, das zu verstehen hat, was der Antiziganismus ist und wie er in seiner Ausgrenzung funktioniert. Wenn man nicht politisch aktiv ist, und das sind auch in Deutschland nur fünf Prozent, dann nennt man sich halt Zigeuner.
SPIEGEL: Herr Reinhardt ist aber durchaus politisch aktiv, oder? Fehlt ihm nur das Bewusstsein, sich als Opfer von Diskriminierung zu sehen?
Knudsen: Der Antiziganismus wird unhinterfragt, von Generation zu Generation, wie ein europäischer Kulturkodex weitergegeben. Dieses sollte sich Herr Reinhardt zu Herzen nehmen, denn »Zigeuner« sein, das ist keine Identität. Sondern ein Klischee.
Reinhardt: Vielleicht ziehen wir beide auf unsere eigene Weise doch am gleichen Strang.